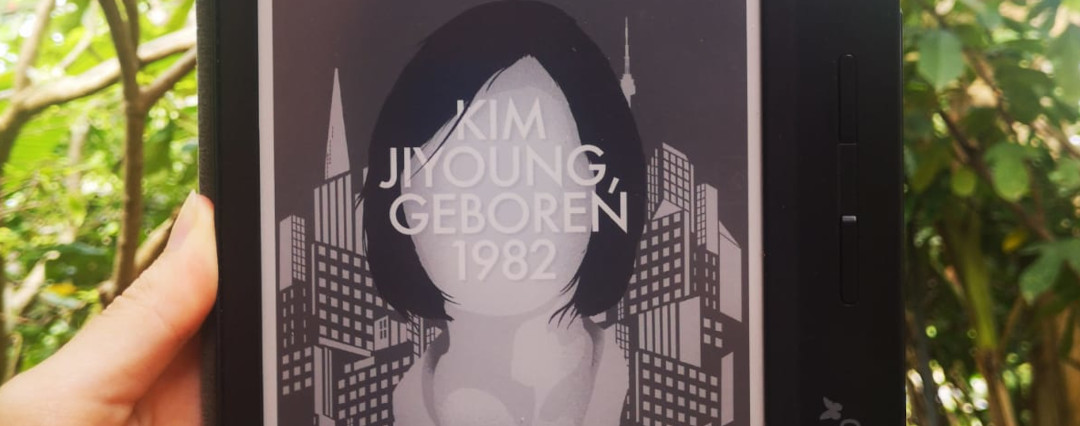Bei Kim Jiyoung, geboren 1982 handelt es sich um das erste koreanische Buch, das ich gelesen habe. Die Autorin Cho Nam-Joo wurde 1978 in Seoul, Korea geboren. Sie war lange Zeit als Drehbuchautorin tätig. Bei Kim Jiyoung, geboren 1982 handelt es sich um ihren dritten Roman, durch den in Südkorea eine große Debatte über Gleichberechtigung und Diskriminierung von Frauen ausgelöst wurde. Durch ihn erlangte Cho Nam-Joo außerdem nicht nur in Korea, sondern auch international Bekanntheit. Im Buch gibt sie teilweise eigene Erfahrungen wieder. Sie betont jedoch, dass ihre Erfahrungen mit denen vieler Frauen in Südkorea übereinstimmen. So kann das Leben Kim Jiyoungs beispielhaft für die Erfahrungen einer ganzen Generation von Frauen stehen.
Liebe Cho,
In deinem Buch erzählst du vom Leben der Protagonistin Kim Jiyoung, die 1982 in Seoul, Korea geboren wird. Das Buch startet im Herbst 2015, in dem eine psychische Krankheit bei Kim Jiyoung diagnostiziert wird. Danach wird ihr Leben chronologisch erzählt. Die Erzählung endet 2016, als sie einen Psychologen aufsucht. Die psychische Erkrankung spielt im Buch jedoch keine weitere Rolle. Stattdessen geht es darum, welche Umstände zu Kim Jiyoungs Erkrankung führen.
Als Erstes erzählst du von der Kindheit Kim Jiyoungs und webst dabei Erlebnisse ihrer Mutter ein, die ihre Bildung dafür opfert, Geld für die Ausbildung ihrer Brüder zu beschaffen. Damals ist es gesellschaftlicher Konsens, es sei Aufgabe der Söhne bzw. Männer, für die Familie zu sorgen (Park Jae-Hyong & Kim Hyong-Jae: Zufallsfamilien: Wohnblockskinder, S. 61, 2015 Mati Verlag). Als Kim Jiyoungs Mutter erwachsen ist, bringt sie zwei Töchter und einen Sohn zur Welt. Der Druck ihrer Schwiegermutter, es sei besser einen Sohn zu bekommen, lastet dabei schwer auf ihr. So kommt es, dass die Geburt des dritten Kindes – Kim Jiyoungs Bruder – einen Befreiungsschlag für ihre Mutter darstellt. Im Jahr 1982 kommen in Südkorea aufgrund der mittlerweile gesellschaftlich akzeptierten Geburtenkontrolle auf 100 Mädchen 106,8 Jungen. Bis 1990 steigt der Anteil der Jungen sogar auf 116,5. Der natürliche Anteil läge bei einem Verhältnis von maximal 107 zu 103 (Statistik der Bevölkerungsmigration und -entwicklung, Statistikamt Koreas).
Kim Jiyoung muss in ihrem Leben immer wieder erfahren, wie Mädchen gegenüber Jungen und Frauen gegenüber Männern benachteiligt werden. In ihrer Kindheit sind sie und ihre Schwester in einem viel früheren Alter als ihr Bruder verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. In der Grundschule werden die Jungen bei der Vergabe des Essens bevorzugt und Mobbing in der Schule wird damit abgetan, dass der Junge Kim Jiyoung „eben gernhabe“ und es „nicht anders zu zeigen wisse“. Auf der weiterführenden Schule müssen die Mädchen sich an strenge Kleidungsvorschriften halten, während bei den Jungen ein Auge zugedrückt wird, da es normal sei, dass diese „nicht die Füße stillhalten können“. In Kim Jiyoungs Jugend werden Belästigungen von Männern damit abgetan, sie sei selbst Schuld, da sie sich nicht an die Regeln gehalten habe. In der Universität muss sie die Erfahrung machen, dass ihre männlichen Kommilitonen hinter ihrem Rücken schlecht über sie reden, weil sie es wagt, die Beziehung mit ihrem damaligen Freund zu beenden und sich ein Stück sexuelle Selbstbestimmung herauszunehmen. Bei der Bewerbung um einen Job muss sie unangebrachte Fragen über sich ergehen lassen. In der Firma, in der sie als junge Frau arbeitet, wird ein Belästigungsskandal unter den Teppich gekehrt. Kim Jiyoung bekommt ein Kind, ohne sich anfangs sicher zu sein, ob sie es überhaupt haben möchte. Trotz der Versprechen ihres Mannes, er unterstütze sie in der Erziehung des Kindes, übernimmt sie wie selbstverständlich einen Großteil der Sorgearbeit. Männer strafen ihre damit einhergehende Erwerbslosigkeit mit gehässigen Kommentaren.
Während Jungs sich ganz natürlich als Erste in die Schlange stellten, als Erste ihr Referat halten durften und ihre Hausaufgaben als Erstes kontrolliert wurden, warteten Mädchen still darauf, an die Reihe zu kommen, manchmal ein bisschen gelangweilt, manchmal erleichtert, aber niemals irritiert darüber. So wie niemand hinterfragt, warum die Nummer des Personalausweises bei Männern mit einer 1 und bei Frauen mit der Ziffer 2 beginnt.
S. 30
Das Buch selbst ist sehr rational geschrieben und immer wieder mit Fakten unterlegt, kommt jedoch ohne jegliche Bewertungen aus. Genau dieser Stil macht es jedoch so eindringlich. Er ist perfekt gewählt, denn er macht wütend. Vor allem das Ende des Buches, über das ich hier noch nichts verraten werde, lässt mich immer noch staunend zurück und enttarnt das Unverständnis von Männern, auf das man oftmals trifft, sobald Missstände in den Geschlechterverhältnissen angesprochen werden.
Nach dem Lesen dieses Buches bin ich wütend darüber, dass jegliche Frauen auch in meinem Umfeld mindestens eine ähnliche Situation wie die oben beschriebenen erleben mussten. Wütend darüber, dass Sorgearbeit 40 Jahre später immer noch zum größten Teil in die Hände der Frauen fällt und weder als Arbeit anerkannt wird noch Wertschätzung erfährt. Wütend darüber, dass sich viele Menschen nicht einmal bewusst darüber sind, in einem patriarchalem System zu leben. Wütend darüber, wie selbstverständlich dieses System heute noch ist und wie schwierig es sein wird, diesen Kreislauf zu durchbrechen.
Doch genau diese Wut braucht es, um etwas zu bewegen. Denn nach dem Lesen dieses Buches ist es wichtig, sich eins vor Augen zu halten: Nicht nur ich verspüre diese Wut. Da draußen sind tausende anderer Frauen, nicht cis-Personen und sogar Männer, die genauso fühlen. Und eine davon bist offensichtlich du. Danke, Cho, dass du dieses Buch geschrieben hast und mir mal wieder gezeigt hast, dass ich nicht allein mit solchen Erlebnissen bin, sondern dass diese Phänomene Frauen in Deutschland, Korea und weltweit widerfahren.
Magda
Das war mein Review des Buches „Kim Jiyoung, geboren 1982“ von Cho Nam-Joo. Für die neuesten Updates, weitere Rezensionen und Buchempfehlungen folgt mir gern auf Instagram.